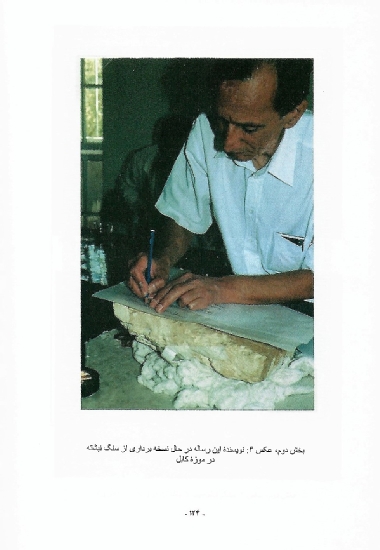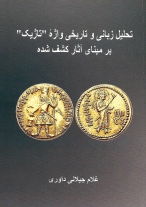LES EDITIONS BAMIYAN
ASSOCIATION DE LA CULTURE AFGHANE
Sprach-historische Analyse des Wortes Tāžīk anhand der neuentdeckten Materialien
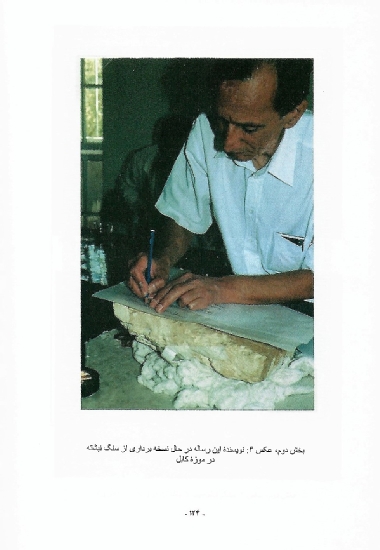
Impressionen aus der Monographie: Der bekannte Orientalist Herr DAVARY bei seiner wissenschaftlichen Arbeit - Copyright: Les Editions Bamiyan
Sprach-historische Analyse des Wortes Tāžīk anhand der neuentdeckten Materialien
Der bekannte Orientalist Herr DAVARY hat neuerdings eine
Monographie mit dem Titel „Sprach-historische Analyse des
Wortes Tāžīk anhand der neuentdeckten Materialien“ in
persischer Sprache geschrieben. Es handelt sich dabei um die
Lesung und Kommentierung einer Inschrift in baktrischer Sprache
(einer ostmitteliranischen Sprache), die nun im Kabul-Museum
ausgestellt ist. Der Verfasser sah sich im Zusammenhang mit dem
Inhalt dieser Inschrift veranlasst, einige allgemein
historisch-philologischen Aspekte der iranischen Kultur zu
erörtern. Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich wie folgt:
Abschnitt 1 (7 - 20)
Der Ursprungsort der indoarischen
und iranoarischen Stämme und die Wurzeln ihrer Sprachen:
Es wird anhand archäologischer
Ergebnisse und sprach-historischer Forschung kurz erklärt, wo
ursprünglich die indoarischen und iranoarischen Stämme gelebt
haben könnten, bevor sie sich trennten. Es wird auch erläutert,
dass die Sprachen beider Volksstämme miteinander verwandt sind
und auf indogermanische Wurzeln zurückgehen.
Abschnitt 2 (21 - 24)
Der Große Gott Ahura Mazda:
Nach kurzer Darstellung des Wesens und des Wirkens dieses
großen Gottes (baga vazraka) im alten Iran wird seine
Funktion und seine Stellung anhand von numismatischen Quellen
in Ostiran beschrieben. Es wird dabei auch deutlich, dass
dieser große Gott im Reich der Kušān nicht mehr der allmächtige
Gott war, sondern dass die Göttin Nana dem großen Gott
Ahura Mazda den ersten Platz in der Liste der Götter im
kušānischen Pantheon streitig machte.
Abschnitt 4 (30 - 32)
Gott-König Yima:
Aufgrund numismatischer Quellen wird die Rolle dieses
Gott-Königs in Ostiran erklärt. Das Porträt von Yima mit der
baktrischen Legende iamšo auf dem Revers einer Münze
des Kaisers Huviška aus der Kušān-Dynastie wird zudem
numismatisch, historisch und sprachlich erörtert.
Abschnitt 5 (33 - 37)
Der Name Khorasan:
Zunächst wird der Name Khorasan sprachwissenschaftlich
definiert und anschließend anhand von numismatischen Quellen
dargelegt, dass damit ursprünglich das Hindukuschgebirge im
nordöstlichen Gebiet von Afghanistan gemeint ist. Ferner wird
sowohl numismatisch als auch aufgrund der baktrischen
Materialien darauf hingewiesen, dass neben dem mitteliranischen
Namen xwarāsān auch die baktrischen Namen
uōrsano und mirosano in diesem Raum
gebräuchlich waren.
Abschnitt 6 (59 - 83)
Das Wort Tāzīg/Tāzīk:
Anhand der neu entdeckten baktrischen Inschrift von Yakaolang
in Bamiyan / Afghanistan und weiterhin anhand der Münzen eines
Königs mit dem stolzen Titel fromo kēsaro
= „Kaiser von Ostrom“ sowie eines manichäisch-parthischen
Fragments aus der Turfansammlung wird der Volksname
Tajik untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass das
Wort Tāzīg/Tāzīk der Name des tadschikischen Volkes
ist und dieser nicht mit dem Namen der Araber Tazī
verwechselt werden darf.
Diese Monographie ist im Verlag „Bamiyan“ (Association
de la culture afghane), 18, rue Rhin et Danube, 87280 Limoges
unter ISBN 978-2-91 4245-63-0 erschienen.
Aufgrund seiner orientalistischen
Forschungsarbeiten wurde der Verfasser vom tadschikischen
Präsidenten Imam Ali Rahman anlässlich seines offiziellen
Besuchs in Deutschland am 10. Dezember 2011 zusammen mit Prof.
Manfred Lorenz und Prof. Lutz Rzehak von der
Humboldt-Universität Berlin geehrt.
Ein Artikel des Verfassers mit dem Titel: „Die
Kunstgeschichte Afghanistans“ (in: Afghanistan
- Eine große Vergangenheit und die Zukunft?).
Katalog einer Ausstellung der Universitäts-bibliothek Trier Nr.
21, S. 33-89, 1990, ist bereits auf unserer Homepage
(www.museo-on.com) erschienen.